Das digitale Archiv versammelt zahlreiche Informationen und Materialien zu den Aktivitäten der dfi seit ihrer Gründung als Nachfolgeinstitution des Europäischen Dokumentarfilm-Instituts (EDI) vor über 25 Jahren. Das gesamte Archiv oder ausgewählte Kategorien können seitenweise und anhand des Zeitstrahls chronologisch durchstöbert werden. Außerdem können über die Lupe beliebige Begriffe gesucht werden. Eine Eingrenzung der Suchergebisse ist durch die Auswahl von Filtern möglich.
Archiv
-

dfi-Kooperation mit der Duisburger Filmwoche
50 Jahre Gegenwart
2026
-

Kooperation mit LaDOC
Bread & Roses
2025
-
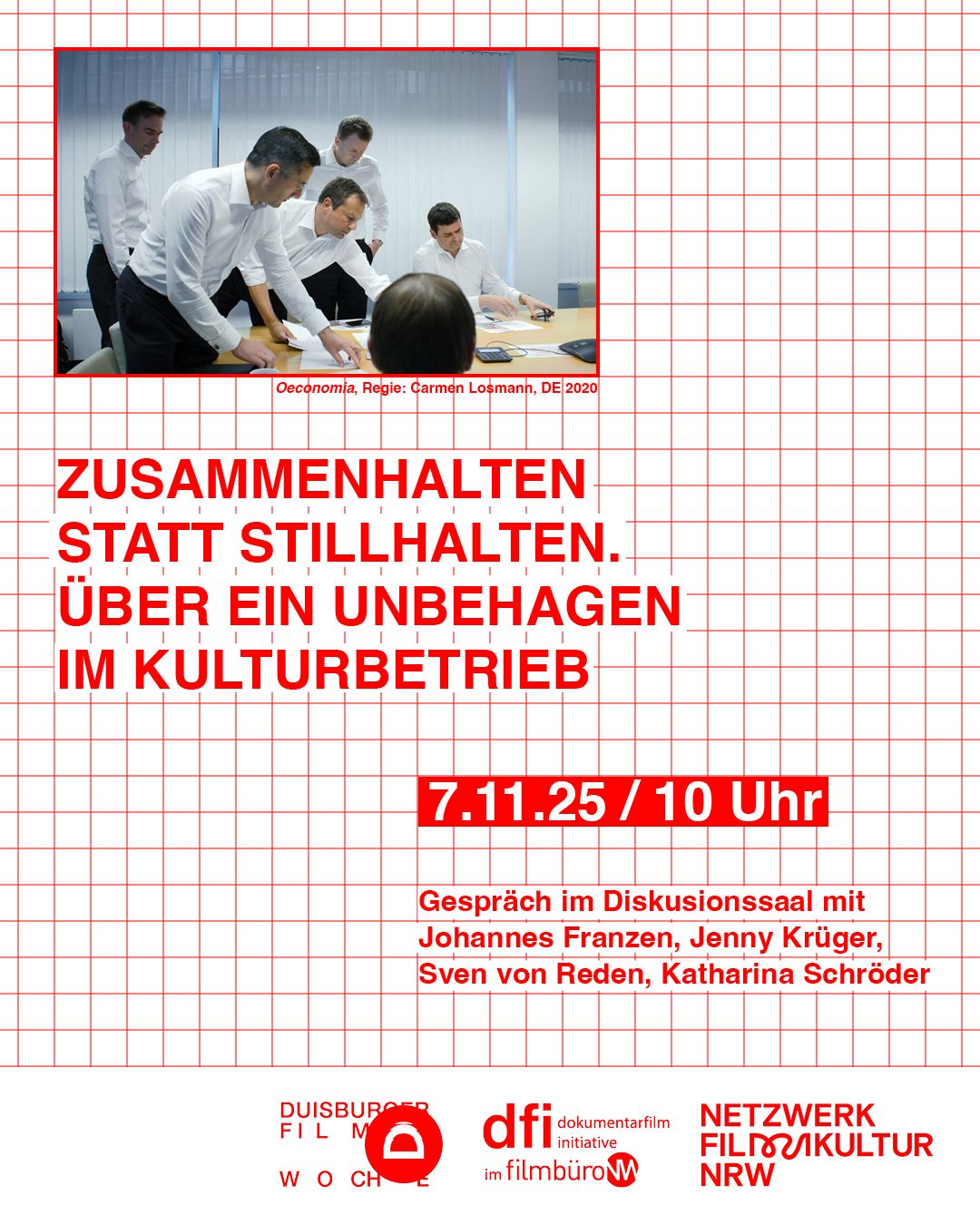
Kooperation mit der Duisburger Filmwoche
ZUSAMMENHALTEN STATT STILLHALTEN.
2025
-

Kooperation mit dem Kasseler Dokfest
Stolz & Eigensinn
2025
-

Kooperation mit LaDOC
Next Generation
2025
-

Kooperation mit DOXS RUHR
DOCracy Award
2025
-

dfi-Kooperation mit LETsDOK
"The Pickers"
2025
-

Hartmut Bitomsky – Nachruf auf einen Kritiker
2025
